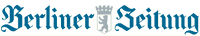
Der unbekannte Alltag
Im Centrum Judaicum informiert
eine Ausstellung über jüdisches Leben in Deutschland
Beim Cheeseburger ist noch alles
klar. "Nicht koscher", sagt der 15-Jährige aus Bielefeld, und
sein Vater ergänzt: "Milch und Fleisch dürfen nicht zusammen
gegessen werden." Ein Blick auf die Leuchttafel im Treppenhaus der
Neuen Synagoge bestätigt es. Unter einem orangen Burger-Zeichen steht:
"Ein Cheeseburger kann niemals koscher sein." Aber wie sieht
sonst der Alltag von jüdischen Deutschen aus? Müssen junge Juden zur
Bundeswehr? Gibt es weibliche Rabbiner? Wie viele Juden besuchen regelmäßig
die Synagoge? Da müssen Vater und Sohn, die an diesem Freitag durch die
Ausstellung im Centrum Judaicum schlendern, passen. "Ich weiß
nichts über den jüdischen Alltag", sagt der Junge. "In der
Schule haben wir über die Nazi-Zeit gesprochen, aber nicht über so
was."
Chana Schütz vom Centrum
Judaicum findet das nicht verwunderlich. "Die meisten Nicht-Juden
in Deutschland wissen ganz gut über die Geschichte Bescheid", sagt
sie. Nur die Gegenwart sei ihnen kaum bekannt. "Fragen zur
Privatsphäre von Juden wagen viele nicht zu stellen." Das Centrum
Judaicum hat daher die Wanderausstellung "Zeichen des Alltags"
eingeladen. Die Kunstinstallation, entwickelt vom Berliner Ausstellungsbüro
x:hibit und dem Jüdischen Museum Franken, ist bis zum 20. Mai zu sehen.
Sie soll Vorurteile ausräumen und das Thema "Juden in
Deutschland" mal unkonventionell behandeln.
Inmitten der historischen
Dauerausstellung über die Geschichte der Neuen Synagoge stehen 26
Leuchttafeln. Jede Tafel ist mit einem Symbol, einem so genannten
Piktogramm, und mit einem kurzen Text versehen. Das wirkt großstädtisch
und modern - ein gewollter Kontrast zu den alten Thorarollen, Lampen und
Steinen in den Glasvitrinen der Dauerausstellung. Auf einer Tafel
leuchten zwei gelbe Eheringe. Darunter steht, dass es seit 1987 in
Frankfurt eine jüdische Heiratsvermittlung gibt. Etwa einmal im Monat
gelinge eine Eheanbahnung. Auf anderen Leuchttafeln werden die
Internet-Adresse für jüdische Nachrichten und ein Verein für schwule,
lesbische und bisexuelle Juden genannt. Eine Tafel berichtet vom Service
des Berliner Hotels Savoy: Damit Gäste die Shabbat-Ruhe einhalten können,
gibt es eigens Angestellte, die ihnen die Türen aufschließen und für
sie den Lift bedienen.
"Ich finde das alles sehr
interessant", sagt Susanne Nordsieck, eine alte Dame, die aus dem
Ruhrgebiet für ein Wochenende in Berlin ist. Sie hat viel über die jüdische
Geschichte gelesen, aber jüdische Bekannte hat sie nicht: "Es gibt
ja kaum noch Juden bei uns." Die 70-Jährige beugt sich vor, um zu
lesen, was unter einem leuchtend orangen Hakenkreuz steht: Jeden dritten
Tag werde in Deutschland ein jüdischer Friedhof geschändet.
Versicherungen weigerten sich inzwischen, Verträge mit jüdischen
Gemeinden abzuschließen. Susanne Nordsieck atmet tief durch: "Das
ist erschütternd."
Die meisten Besucher sind
Touristen. Sie wollen in erster Linie etwas über die Geschichte der
Neuen Synagoge erfahren. Die Wanderausstellung ist für sie eine
willkommene Ergänzung. Ein Mann liest seinen beiden Jungen vor, dass
ein bis zwei Prozent der jüdischen Deutschen am Shabbat eine Synagoge
besuchen. Er ist überrascht: "Ich dachte, es sind viel mehr."
Zwei junge Frauen aus Westdeutschland haben bislang angenommen, dass
alle Juden vom Wehrdienst befreit sind. Nun lesen sie, dass nur die
Kinder und Enkel von NS-Verfolgten nicht zur Bundeswehr müssen.
Enttäuscht reagiert nur eine
Amerikanerin auf die Ausstellung: Sie kann die Texte nicht lesen, weil
sie nur in Deutsch und Russisch verfasst wurden - Letzteres, um jüdische
Immigranten aus Osteuropa anzusprechen "Ich hätte gerne mehr über
die Situation von Juden in Deutschland gewusst", sagt die
Amerikanerin. Zum Beispiel: "Warum stehen so viele Polizisten vor
der Synagoge? Warum müssen alle Ausstellungsbesucher durch eine
Sicherheitsschleuse?" Die Wachleute können es ihr sagen: Auch die
Furcht vor Anschlägen gehört zum jüdischen Alltag in Deutschland.
[Zeichen
des Alltags]
Jüdisches
Leben in Berlin |
